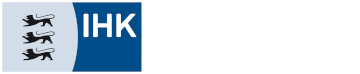Baden-Württemberg hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1952 zu einem der lebenswertesten und wirtschaftsstärksten Bundesländer in Deutschland entwickelt. Mit über 11 Mio. Einwohnern ist Baden-Württemberg das drittgrößte Bundesland, belegt im Länderranking nach Bruttowertschöpfung pro Einwohner Platz 4 und weist deutschlandweit mit 40 Prozent den höchsten Anteil von produzierendem Gewerbe an der Wirtschaft auf. Baden-Württemberg gilt mit seinen kreativen, neugierigen und fleißigen Menschen als Innovationsland Nummer 1 in Europa. Es weist die höchste technologische Leistungsfähigkeit mit dem höchsten Anteil an Beschäftigten in Hochtechnologiebranchen und einer überdurchschnittlichen Patentdichte auf. Zugleich wird im Südwesten das gesellschaftliche Leben wie in keinem anderen Bundesland durch die große Zahl an ehrenamtlich und zivilgesellschaftlich Engagierten bereichert.
Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg Baden-Württembergs war und ist dabei die gemeinsam gelebte Verantwortung von Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft für das Gelingen einer auf Wohlstand basierenden und zugleich verantwortungsbewussten Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung. So ist es durch eine an den Bedarfen der jeweiligen Raumschaft ermöglichten Landesentwicklung gelungen, Baden Württemberg zu dem Bundesland zu machen, in dem die volkswirtschaftliche Wertschöpfung so gleichmäßig wie nirgends sonst in urbanen und ländlichen Räumen stattfindet.
Es gehört zum Erfolgsrezept Baden-Württembergs, dass Wirtschaft, Zivilgesellschaft und öffentliche Hand immer mit dem Fokus auf die Gesamtgesellschaft, das Gelingen der Daseinsvorsorge und die Stärke des Gemeinwesens handeln. Der Antrieb hierfür ist jederzeit die Verantwortung für die Menschen in Baden-Württemberg und wird getragen von der Vernunft, mit guten Maßnahmen auch ein gutes und zukünftig erfolgreiches Wirken zu ermöglichen.
Deshalb ist es aus Sicht der Wirtschaft und der Kommunen von zentraler Bedeutung, auch in Zukunft attraktive Standortbedingungen für Baden-Württemberg zu gewährleisten. Dazu zählt auch die Verantwortung, bei politischen Entscheidungen alle Belange abzuwägen und Raum für Zukunft zu geben. Dann gelingt die Energiewende, dann kann Wohnen stattfinden, dann investieren Unternehmen an ihrem heimischen Standort. Die Unternehmen, Kammern, Kommunen und Verbände bekräftigen deshalb unisono: Ohne verfügbare Flächen geht es nicht!
Diese Erfolgsgrundlage muss dringend auch künftig fortgeschrieben werden, um die Prosperität Baden-Württembergs auch weiterhin halten zu können. Diese basiert nicht zuletzt auf der Selbstverwaltung von Kommunen und Wirtschaft, auf ihren Aufgaben der Daseinsvorsorge für Bürger und Betriebe sowie auf dem Anspruch, die Zukunft proaktiv zu gestalten.
Hierbei findet das Ziel, die zusätzliche Flächeninanspruchnahme möglichst gering zu halten, ausdrücklich Zustimmung. Betriebe, Unternehmen, Städte, Gemeinden und Landkreise sowie Verbände bekennen sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich zu einem sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource „Fläche“, der auch den Erhalt der Biodiversität und unserer Lebensgrundlagen sowie der Landwirtschaft berücksichtigt, und betonen in diesem Zuge den Fokus auf die Innenentwicklung.
Der zuletzt deutlich spürbare Rückgang an Innenentwicklungspotenzialen macht das bereits bestehende Engagement der Kommunen mittels zahlreicher lnnenentwicklungsmaßnahmen deutlich. Bei ehrlicher und offener Analyse muss gleichzeitig anerkannt werden, dass das Innenentwicklungspotenzial bezogen auf die Siedlungsfläche für Wohnen, Industrie und Gewerbe (WIG) lediglich rund 4 Prozent entspricht, wie es die Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) zeigen.1 Von den 3.574.785 ha Landesfläche2 entfallen nach Angaben des Statistischen Landesamtes (Stand: 31.12.2022) derzeit 529.627 ha auf die Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV).3 Dies entspricht einem Anteil von 14,8 Prozent an der gesamten Landesfläche. 83,9 Prozent der Landesfläche werden durch Landwirtschaft, Wald und Vegetation genutzt. Die Gewässernutzung entspricht wiederum 1,1 Prozent der Landesfläche.4
Insgesamt 330.025 ha der Siedlungs- und Verkehrsfläche5 zählen zur Siedlungsfläche (62,3 Prozent), 199.602 ha (37,7 Prozent) zum Verkehr. Zur Siedlungsfläche zählen zum Beispiel Wohnbauflächen, Krankenhäuser, Schulen, Industrie- und Gewerbeflächen sowie Flächen mit gemischter Nutzung. Der Indikator der Siedlungs- und Verkehrsfläche trifft allerdings keine Aussage über den tatsächlichen Grad der Versiegelung. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes sind ca. 6,8 Prozent der gesamten Bodenfläche Baden-Württembergs versiegelt, also etwas weniger als die Hälfte der Siedlungs- und Verkehrsfläche.6 So lag der
Anteil versiegelter Fläche an der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Baden-Württemberg im Jahr 2020 bei 46,1 Prozent.7 Insgesamt erfolgt in den 53,9 Prozent der unversiegelten Flächen eine ökologische Aufwertung von Siedlungsflächen durch verschiedene Maßnahmen, wie die Umwandlung in naturnahe Grünflächen, Biotope oder urbanes Grün, welche die Biodiversität in städtischen Gebieten fördern, das Mikroklima verbessern und den Bürgern Erholungsräume bieten. Insofern wird es für eine zukunftsorientierte Entwicklung Baden-Württembergs mit starken Unternehmen und leistungsfähigen Kommunen auch künftig notwendig sein, zusätzlich zu den Bemühungen um innerörtliche Entwicklung neue Flächen in Anspruch zu nehmen – aus Verantwortung und orientiert an der Realität. Nur so kann das Leistungsversprechen zur Daseinsvorsorge erfüllt werden. Nur dann sind Verantwortung, Pflicht, Gestaltungsanspruch und kommunale Realität im Einklang.
Denn jede Fläche, die für den Betrieb eines Unternehmens erschlossen und bauleitplanerisch festgesetzt wird, stellt abseits der unternehmerischen Wertschöpfung gleichzeitig auch einen wichtigen Mehrwert für Gesellschaft und Gemeinwesen dar. Begonnen beim Schaffen von (wohnortnahen) Arbeitsplätzen, die einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz darstellen und zudem wirtschaftliche Folgeentwicklungen wie Kaufkraftsteigerungen, Betriebsinvestitionen und örtliche Handwerker- und Dienstleistungsaufträge begünstigen, bis hin zu den dadurch begründeten Steuereinnahmen wie auch der sozialen Verantwortung der Unternehmen und Betriebe für örtliche Vereine. Verantwortung für konkrete Zukunftsgestaltung in den Städten und Gemeinden benötigt aber ganz konkret Flächen, Vertrauen und Werkzeuge.
Es bedarf einer Ermöglichungsplanung. So braucht es eine neue Betrachtungsweise, wann Fläche beansprucht und tatsächlich versiegelt ist. Fläche lässt sich im engeren Wortsinn nicht
„verbrauchen“, sondern wird genutzt. Der Flächengebrauch und die Flächeninanspruchnahme für die Zukunft des Landes Baden-Württemberg brauchen richtigerweise Rahmenbedingungen. Dadurch können auch langfristig nachhaltige Lösungen mit Blick auf die landwirtschaftlichen Flächen entwickelt werden.
Bei der Betrachtung der Flächenbedarfe gilt immer, dass neben den eigentlich genutzten Flächen auch weitere Flächen zur statistischen Nutzungsart der Siedlungs- und Verkehrsflächen zählen. Hierzu gehören insbesondere auch die Ausgleichsflächen von Vorhaben, sodass die realitätsorientierte Betrachtung diesen Umstand berücksichtigen muss und sich das Maß der benötigten Fläche erhöht.
Schlussfolgerung:
Die Bedarfsbeispiele, in denen Kommunen, Unternehmen, Betriebe und Bau- und Wohnungswirtschaft Verantwortung für Baden-Württemberg übernehmen, zeigen klar auf, wo für die Zukunft von Baden-Württemberg Flächenbedarfe bestehen. Allein die dafür aufgezeigten Bedarfe begründen einen Flächenbedarf von mindestens plus 2,4 % der Gesamtfläche Baden-Württembergs (dies entspricht 86.000 ha zusätzlicher Flächen) in den nächsten beiden Jahrzenten, um die aktuellen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgreich zu meistern. In einer sich schnell verändernden Welt muss zudem eine Grundlage dafür geschaffen werden, auch auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können. Deshalb braucht es einen Ermöglichungsrahmen, der auf Vertrauen in die Subsidiarität basiert.
Es ist der gemeinsame Auftrag von Landtag und Landesregierung, bei allen politischen Weichenstellungen und Entscheidungen die Gesamtheit der Bedarfe zu berücksichtigen. Insbesondere in den weiteren politischen Schritten bei der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans, bei der Ansiedlungsstrategie oder bei der Energiewende müssen die aufgezeigten Bedarfe im politischen Prozess als Grundlage der Entscheidung dienen. Zukunft braucht Fläche! Zukunft braucht Gestaltungsmögliehkeit!
Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag
Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern (IHKs). In Baden-Württemberg vertreten zwölf IHKs die Interessen von weit mehr als 650.000 Mitgliedsunternehmen. Der BWIHK folgt der Aufgabe, in allen die baden-württembergische Wirtschaft und die Mitgliedskammern betreffenden Dingen gemeinsame Positionen zu finden und diese gegenüber Politik als auch der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. Fach/ich arbeitet der BWIHK nach dem Federführerprinzip, bei dem einzelne IHKs bei Sachthemen von A wie Ausbildung bis Z wie Zollpapiere die Sprecherfunktion für alle IHKs im Land wahrnehmen. Die Fachexpertise wird dabei in Arbeitskreisen mit Mitgliedern aus allen zwölf IHKs gebildet und Inhalte für die Arbeit und zur politischen Diskussion abgestimmt.
HANDWERK BW – Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V.
HANDWERK BW steht für den Baden-Württembergischen Handwerkstag. Wir sind der Dachverband der Handwerksorganisationen im Südwesten. Unsere Mitglieder sind Handwerkskammern, Fachverbände und weitere Partnerorganisationen. Als Repräsentant von 140.000 Betrieben, 800.000 Beschäftigten und 48.000 Auszubildenden sind wir die Stimme fürs Handwerk BW Als Dachverband der Handwerksorganisationen in Baden Württemberg bündelt HANDWERK BW die Arbeit von Handwerkskammern und Fachverbänden des Handwerks auf Landesebene und spricht mit einer Stimme gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Mehr unter www.handwerk-bw.de.
UBW Unternehmer Baden-Württemberg
Der Dachverband Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) bündelt und moderiert die wirtschafts-, sozial-, arbeits-, gesellschafts- und bildungspolitischen Interessen von 64 Mitgliedsverbänden sowie mehr als 70 Einzelunternehmen aus Industrie, Dienstleistung, Handel, Handwerk und Landwirtschaft. Das oberste Ziel der UBW· den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg nachhaltig stärken. Dazu soll vor allem die Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft verbessert werden nach den Prinzipien der unternehmerischen Freiheit, der Tarifautonomie, der Eigeninitiative und der Chancengleichheit.
Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.
In der Bauwirtschaft Baden-Württemberg sind rund 1.500 Mitgliedsbetriebe aus den Bereichen Baugewerbe und Bauindustrie, darunter 37 Fachinnungen, zusammengeschlossen. Sie unterhält drei Geschäftsstellen in Stuttgart, Freiburg und Mannheim und vertritt u.a. die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Politik und Öffentlichkeit.
Mit ihrer Bildungsakademie sichert die Bauwirtschaft – an 11 Standorten in Baden Württemberg verteilt – die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Baunachwuchses.
vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
Im vbw sind 273 gemeinwoh/orientierte Wohnungs- und Immobilienunternehmen organisiert. Zwei Drittel der Unternehmen tragen die Rechtsform der Genossenschaft, ein Drittel zählt zu den Unternehmen der Gebietskörperschaften und der Sozialverbände. Sie bewirtschaften rund 460.000 Wohnungen und investieren jährlich mehr als 2 Milliarden Euro in die Instandhaltung und Modernisierung ihres Wohnungsbestandes sowie in den Wohnungsneubau. Sie geben knapp einer Million Menschen in Baden-Württemberg ein Zuhause.
BFW Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Landesverband Baden-Württemberg e. V.
Im BFW, dem Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen sind bereits seit 1946 überwiegend mittelständische Immobilienunternehmen organisiert. Mit bundesweit rund 1600 Mitgliedern sind die im BFW zusammengeschlossenen Unternehmen für rund 50
% des Wohnungsneubaus in Deutschland und für 30 % bei Gewerbebauten verantwortlich. Die im BFW Baden-Württemberg organisierten Bauträger und Projektentwickler bauen neue Wohngebäude aller Art, für Selbstnutzer ebenso wie für Kapitalanleger.
Haus & Grund – Arbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg
Die Arbeitsgemeinschaft Haus & Grund Baden-Württemberg, bestehend aus den Verbänden Haus & Grund Baden und Haus & Grund Württemberg vertreten die Interessen des privaten Haus- & Grundeigentums in Baden-Württemberg. Zusammen vertreten die beiden Verbände im Land in 103 Ortsvereinen über 185.000 Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer, denen im Land mehr als 1,2 Mio. Wohnungen gehören.
Arbeitsgemeinschaft der Baden-Württembergischen Bausparkassen
Die Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkassen (ARGE) versteht sich als Einrichtung zur Erörterung von gesellschaftspolitisch relevanten Themen rund um das selbstgenutzte Wohneigentum. Hierzu gehören das Erreichen der Klimaziele im Gebäudebestand ebenso wie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Die ARGE sieht die Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum als einen Baustein für eine solide Vermögensbildung, sichere private Altersvorsorge und für gesellschaftspolitische Stabilität.
Der Arbeitsgemeinschaft gehören die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, die Bausparkasse Badenia AG, die Landesbausparkasse LBS Süd und die Wüstenrot Bausparkasse AG an.
KOWO Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunternehmen
In der Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunternehmen (KoWo) haben sich rund 60 kommunale und landkreisbezogene Wohnungsunternehmen zusammengeschlossen. Sie verwalten über 140.000 Mietwohnungen und gehören mit einem Investitionsvolumen von mehr als 1 Mrd. Euro, davon rd. 650 Mio. € im Neubau, zu den wichtigsten Investoren beim Bau bezahlbarer Wohnungen. Ziel der seit 1990 bestehenden Vereinigung ist es, ihre Interessen auf Landesebene zu vertreten und zu bündeln.
Gemeindetag Baden-Württemberg
Der Gemeindetag Baden-Württemberg vertritt 1.065 kreisangehörige Städte und Gemeinden gegenüber dem Landtag, der Landesregierung sowie anderen Institutionen und Verbänden. Neben der lnteressensvertretung repräsentiert der Gemeindetag die kommunalen Belange auf allen politischen Ebenen und steht den Rathäusern mit Beratung und Information zur Seite.
Landkreistag Baden-Württemberg
Der Landkreistag Baden-Württemberg vertritt die 35 baden-württembergischen Landkreise. Als Kommunaler Landesverband hat er die Aufgabe, die Interessen seiner Mitglieder zu bündeln und die Anliegen der Landkreise gegenüber der Landesregierung, dem Landtag sowie anderen Institutionen und Verbänden zu vertreten. Präsident des Landkreistags ist der Tübinger Landrat Joachim Walter, als Hauptgeschäftsführer leitet Prof Dr. Alexis v. Komorowski die Stuttgarter Geschäftsstelle.