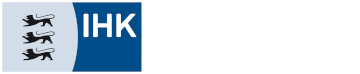Der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg ist als einer der stärksten in Europa überwiegend von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) geprägt. Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie Privatbanken schaffen als verlässliche Partner des Mittelstands die notwendige finanzielle Basis. Um die Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft erhalten zu können, benötigen der Mittelstand und seine Finanzpartner bestmögliche Rahmenbedingungen – gerade auf europäischer Ebene. Dafür müssen das frisch gewählte Europäische Parlament und die neue Europäische Kommission jetzt die richtigen Weichen stellen.
Unsere 4 Prioritäten für die Zukunft der EU-Politik
1. Bürokratieabbau und -vermeidung – verhältnismäßige, sachgerechte und praktikable Regulatorik für Mittelstand und Mittelstandsbanken
Die kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Kreditinstitute sind überproportional stark von Regulierungen betroffen. Die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen bürokratischen Belastungen müssen reduziert werden, damit der Wirtschaftsstandort Europa auch zukünftig im globalen Wettbewerb bestehen kann. Über Initiativen wie dem europäischen Lieferkettengesetz, der Nachhaltigkeitsberichterstattung, der EU-Taxonomie, der Endverbleibserklärung zur Sanktionsdurchsetzung oder den Vorschriften zur Reparatur von Waren sind neue Berichts- und Dokumentationspflichten auf unseren Mittelstand zugekommen, wodurch fortwährend Mehrbelastungen entstehen. Um diese zunehmenden Herausforderungen abzufedern, ist es entscheidend, dass die Auswirkungen der EU-Gesetzgebung auf KMU verbindlich berücksichtigt werden.
Dazu gehört eine umgehende Ernennung des seit 2019 angekündigten KMU-Beauftragten. Dieser muss eine zentrale Rolle darin spielen, die Belange von KMU in der gesamten EU-Kommission gemäß dem „Think Small First“-Prinzip wirksam zu vertreten. Damit dieses Prinzip seine volle Wirkung entfalten kann, müssen bei allen mittelstandsrelevanten
Gesetzen eine konsequente Durchführung von Folgekostenabschätzungen und des KMU-Tests obligatorisch sein. Die Reduzierung von Bürokratie, wie sie mit dem von der Kommission vorgeschlagenen Abbauziel von 25 Prozent angestrebt wird, ist dabei ein wichtiger Schritt. Dazu muss der längst vorhandene „One in, one out“-Grundsatz endlich konsequent zur Anwendung kommen. Darüber hinaus ist eine Bestandsaufnahme erforderlich: Bereits verabschiedete Gesetze müssen auf ihre Umsetzbarkeit für KMU überprüft werden.
Auch mit Blick auf kleine und mittlere Kreditinstitute besteht dringender Handlungsbedarf. Die lange versprochene „Small and Simple Banking Box“ gilt es, mit Vereinfachungen und Ausnahmen für kleinere und mittlere Kreditinstitute sowie ihr vergleichsweise risikoarmes Mittelstandsgeschäft zu befüllen. Insbesondere die Melde- und Dokumentationspflichten belasten kleine und mittlere Institute unverhältnismäßig stark. Es bedarf dringend einer Entlastung der Kreditinstitute von administrativen Lasten, um weiterhin ein zuverlässiger und starker Partner des Mittelstands zu bleiben.
2. Innovation und Innovationsfinanzierung – KMU einbeziehen, Zugang zu Kreditfinanzierung sicherstellen
Der „Letta-Bericht“ zur Reform des europäischen Binnenmarktes macht deutlich, dass sich dieser an die neuen geopolitischen Gegebenheiten anpassen muss, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken. Eine neue gemeinsame Industriestrategie auf EU-Ebene, wie sie auch im Bericht empfohlen wird, ist notwendig, um im globalen Wettbewerb mit den USA und China wirtschaftlich und insbesondere im Bereich Forschung und Innovation nicht weiter zurückzufallen. Wir teilen diese Ansicht, unterstützen eine Vertiefung des EU-Binnenmarktes und plädieren für einen raschen Abbau bestehender und neuer Hemmnisse. Ebenso bedeutend ist die Verbesserung des Innovationstransfers von der Wissenschaft in marktreife Produkte. Dabei helfen: Innovations-Challenges, Reallabore, Experimentierklauseln auf EU-Ebene oder gesteigerte Investitionen in Test- und Validierungsinfrastrukturen sowie Pilotfabriken. Auch die Möglichkeit eines vorgezogenen Starts von Förderprojekten auf eigenes Risiko könnte aus Sicht einiger Unternehmen im Innovationsprozess helfen.
Damit die zwei Hauptprioritäten der EU-Kommission für diese Legislaturperiode – Wohlstand in Europa und Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene – ermöglicht werden können, muss die Kapitalmarktunion vollendet werden. So wird die Kapitalmarktunion unter dem Namen Spar- und Investitionsunion in dieser Legislaturperiode eine der Prioritäten im Finanzbereich sein. Die verstärkte Mobilisierung privaten Kapitals zur Stärkung der Wirtschaft mithilfe der Kapitalmarktunion bzw. Spar- und Investitionsunion ist begrüßenswert. Hierbei muss aber verhindert werden, dass auf dem Weg dorthin nationale Finanzsysteme geschwächt werden. Bei geplanten neuen Fonds und Förderprogrammen ist zu beachten, dass diese KMU ohne großen Verwaltungsaufwand zugänglich gemacht werden.
Für den Mittelstand ist zudem eine ausreichende und stabile Kreditversorgung essentiell. Nur so können die notwendigen Innovationen für einen erfolgreichen Transformationsprozess finanziert werden. In Baden-Württemberg wird dies durch eine Vielzahl an Kreditinstituten geleistet. Gerade die kleinen und nicht-komplexen Institute dürfen in ihrer elementaren Rolle nicht durch übermäßige Regulatorik unnötig beschränkt werden. Auch weitere Einschränkungen der Kreditinstitute durch europäische Abwicklungsregelungen sind kontraproduktiv. Der Vorschlag der EU-Kommission und die Position des Europäischen Parlamentsschwächen die Leistungsfähigkeit der bewährten Institutssicherungssysteme und gefährden die Strukturen des deutschen Bankenmarktes. In den Trilogverhandlungen muss daher gemeinsam an Verbesserungen gearbeitet werden.
3. Digitale Transformation – Gesetze harmonisieren, Potenziale ausschöpfen
Die digitale Transformation ist ein zentraler Treiber für die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit Europas, insbesondere für den Mittelstand. Die Vielzahl an digitalpolitischen Richtlinien und Verordnungen, die in der vergangenen europäischen Legislaturperiode in den Bereichen Daten, Cybersicherheit, Plattformökonomie und Künstliche Intelligenz (KI) verabschiedet wurden, haben tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Trotz einiger positiver Effekte zeigt sich jedoch, dass vor allem KMU durch die Masse an Regulierungen überfordert sind und daher oft vor wichtigen Investitionen in digitale Zukunftstechnologien zurückschrecken. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bedarf es einer zielgerichteten Neujustierung der digitalpolitischen Prioritäten für die neue Legislaturperiode.
Prämisse der neuen EU-Kommission sollte deshalb nicht sein, im gleichen Tempo weiter zu regulieren. Stattdessen muss es darum gehen, die vorhandenen Gesetze sinnvoll aufeinander abzustimmen und zu harmonisieren, ihre Implementierung zu vereinfachen und gleichzeitig Europas digitale Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. Bereits heute ist bei der Vielzahl an Digitalgesetzen unklar, wie weit ihr Geltungsbereich reicht und inwiefern sie mit anderen Gesetzen zusammenhängen. Das führt zu einem erheblichen bürokratischen Aufwand, der insbesondere für KMU kaum zu bewältigen ist. Um Rechtsunsicherheiten, z. B. bei der Entwicklung und Nutzung von KI-Anwendungen, zu vermeiden, müssen der AI Act und andere sektorspezifische Regelungen wie die Medizinprodukteverordnung oder die Maschinenverordnung, aber auch das Datenschutzgesetz und die Datenschutzgrundverordnung klar verständlich und inhaltlich kohärent gestaltet sein, statt sich zu überschneiden oder gar zu widersprechen.
Der geplante Digitale Euro kann Mehrwerte für Wirtschaft und Gesellschaft bieten. Allerdings müssen der europäische Gesetzgeber und die EZB bei seiner Ausgestaltung auf eine konsequente Beibehaltung der klassischen Rollenverteilung zwischen Zentralbank und Privatwirtschaft achten. Dazu darf der Digitale Euro nur als Zahlungsmittel in Ergänzung zum Bargeld und nicht als zusätzliches Zahlverfahren in Konkurrenz zu bereits existierenden Zahlverfahren – wie dem kürzlich eingeführten europäischen Bezahlsystem Wero – eingeführt werden. Nur dann bietet er für die Unternehmen und Verbraucher echte Mehrwerte.
4. Ökologische Transformation – Nachhaltigkeit umsetzungsorientiert gestalten
Damit die ökologische Transformation auch ein ökonomischer Erfolg für unseren Mittelstand wird, erwarten wir, dass in der neuen Legislaturperiode eine Bestandsaufnahme der vielen neuen Gesetze und Berichtspflichten im Nachhaltigkeitsbereich erfolgt. Denn auch hier gilt: Die Vereinfachung, Zusammenführung und vor allem der Abbau von Berichtspflichten sollten oberstes Ziel der neuen Legislaturperiode sein. Insbesondere unerwünschte Effekte, wie die Verlagerung von Berichtspflichten von großen auf kleine Unternehmen, müssen beseitigt werden. KMU sind durch die Abhängigkeit von Auftraggebern und Geschäftspartnern „gezwungen“, die Einhaltung der Regelungen nachzuweisen, ohne dass die Regelungen bereits in Kraft getreten sind oder KMU selbst in deren direkten Geltungsbereich liegen. Das betrifft neben der Nachhaltigkeitsberichterstattung unter anderem auch das EU Lieferkettengesetz.
Darüber hinaus ist eine sichere und bezahlbare Energieversorgung ein entscheidender Standortfaktor für ein auch zukünftig wettbewerbsfähiges Europa. Angesichts des ambitionierten europäischen Klimaziels die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, wird das regulatorische und preisliche Umfeld für die Unternehmen absehbar herausfordernd bleiben. Wir fordern daher Entlastungen im Klima- und Energiebereich, die allen Unternehmen zugutekommen und nicht einzelne Branchen bevorzugen – insbesondere im Hinblick auf den geplanten Rechtsakt zur Dekarbonisierung der Industrie. Auch im Bereich der Verordnung für chemische Stoffe (REACH) muss es Vereinfachungen für KMU geben. Das betrifft beispielsweise Informationspflichten – gerade im Falle von Unikaten und Kleinserien. Keine taugliche Vereinfachung ist der im Zusammenhang mit der angekündigten REACH-Revision diskutierte generische Ansatz. Ein pauschales Verbot der gesamten Stoffgruppe der PFAS (per- und polyfluorierter Alkylsubstanzen) würde wichtige Teile des baden-württembergischen Mittelstandes, ins- besondere die Zukunftsbranche der erneuerbaren Energien, vor technisch und wirtschaftlich kaum lösbare Herausforderungen stellen und damit die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft in ihrer Gesamtheit gefährden.
Auch die Kreditinstitute sind in der ökologischen Transformation gefordert. Wir plädieren für eine schlanke und praxisgerechte Ausgestaltung der EU Taxonomie. Die ihr zugrundeliegende Green Asset Ratio, die seit Anfang 2024 gilt, soll künftig aufzeigen, wie nachhaltig das Kreditportfolio der jeweiligen Bank ist. In ihrer jetzigen Form bildet die Green Asset Ratio das Nachhaltigkeitsprofil der Unternehmen und Banken allerdings nur sehr unzureichend ab. Denn einerseits deckt die EU-Taxonomie derzeit nur einen kleinen Teil der Wirtschaft ab. Andererseits dürfen in die derzeitige Berechnung nur Kredite an Großunternehmen aufgenommen werden. Kredite an kleine Unternehmen, die selbst keiner ESG-Berichtspflicht unterliegen, werden nicht abgebildet. In der Berechnung der Green Asset Ratio ergibt sich dadurch eine Verzerrung, die Kredite an KMU für die Banken mit Blick auf ihr Nachhaltigkeitsprofil weniger attraktiv macht. Dieser Fehlanreiz, der durch die Asymmetrie in der Berechnung entsteht, muss dringend überarbeitet werden.