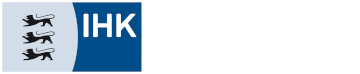Baden-Württemberg plant bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Ziel dieser Studie ist eine Analyse der Versorgungssituation für den Energieträger Strom in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2040. Dabei wird die potenzielle Entwicklung sowohl des Stromangebots als auch des Strombedarfs analysiert. Um den zukünftigen Strombedarf in Baden-Württemberg abzuschätzen, werden drei Szenarien für die mögliche Bandbreite des Strombedarfs bis zum Jahr 2040 entwickelt. Zur Reduktion der CO2-Emissionen und zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2040 ist eine weitgehende Elektrifizierung im Industriesektor sowie in den anderen Sektoren unumgänglich. Daher zeigt jedes der drei Szenarien einen deutlich steigenden Strombedarf im Sektor Industrie auf. Der Strombedarf in Baden-Württemberg steigt von 64 TWh (2021) auf 108 bis 161 TWh im Jahr 2040. Dies entspricht einer Steigerung von rund 73 % bis 156 %.
Der Industriestrombedarf wird im Vergleich zum Strombedarf des Gewerbes bis zum Jahr 2040 stärker wachsen: Der Strombedarf für Gewerbe/Handel/Dienstleistungen (GHD) steigt um 2 % bis 41 % im Vergleich zum heutigen Strombedarf. In der Industrie liegt die Steigerung je nach Szenario bei 5 % bis 65 %. Dabei wird ein hoher Strombedarf vor allem in der Grundstoffchemie, der Metallindustrie und im Papiergewerbe erwartet. Prozentual wird in der Branche „Glas, Keramik und Zement“ der größte Anstieg mit 110 % (1,0 auf 2,1 TWh) erwartet. In den übrigen Branchen liegt der erwartete Anstieg im Basisszenario zwischen 22 % und 89 %. Der Anstieg sollte insgesamt niedriger ausfallen und sich am unteren Ende der Entwicklungsspanne befinden, wenn Energieeffizienzmaßnahmen im Zuge von Elektrifizierungsmaßnahmen oder Umbauten an der Energieversorgung stringent berücksichtigt werden. Neben den Elektrifizierungsmaßnahmen zahlreicher Prozesse, die heute mit fossilen Energieträgern betrieben werden, werden die Energieträger Biogas und Wasserstoff eine Ergänzung darstellen.
Um den steigenden Strombedarf klimaneutral und mit verbrauchsnaher Stromerzeugung zu decken, ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg unerlässlich. Das ermittelte technische Potenzial für Solaranlagen beläuft sich auf rund 550 TWh in Baden-Württemberg (464 TWh für Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlagen und 77 TWh für PV Dachanlagen). Die Potenziale für Windkraft liegen bei 125 TWh. Dies berücksichtigt das Potenzial auf generell geeigneten Flächen. Werden auch bedingt geeignete Flächen hinzugezogen, ist das Potenzial sehr viel höher (827 TWh für PV-Freiflächenanlagen und 210 TWh für Windkraft). Ein gut verfügbares Potential von 303 TWh setzt sich aus 77 TWh für PV Dachflächen, 88 TWh für PV-Freiflächen (ca. 2% der Landesfläche) und 125 TWh für Windkraft sowie kleineren Anteilen von Wasserkraft und Biomasse zusammen. Die Stromnachfrage in 2040 wird mit dem Zubau von Erneuerbaren Energien auf Basis der Landesziele verglichen. Die Stromerzeugung von Photovoltaikanlagen in 2040 auf Basis der Ziele beträgt jährlich 30 TWh aus PV-Dachanlagen und 18 TWh aus PV Freiflächenanlagen. Für Windenergie beträgt die Stromerzeugung 32 TWh. Damit ergibt die Summe aus PV- und Windstrom ca. 80 TWh. Hinzu kommt Strom aus biogener Erzeugung und Wasserkraft mit rund 13 TWh pro Jahr.
Die Analyse zeigt, dass das Land Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der landesspezifischen Ziele in 2040 nicht genug Strom aus Erneuerbaren Energien lokal erzeugen kann, um den steigenden Strombedarf jahresbilanziell zu decken. Jahresbilanziell bedeutet an dieser Stelle ein Vergleich der Jahresmengen. Das technische Potenzial hingegen ist sehr viel höher als der errechnete Strombedarf. Es impliziert aber eine vollständige Ausnutzung der verfügbaren Flächen. Das vermutlich erschließbare Potenzial liegt demnach zwischen den politischen Zielen und dem technischen Potenzial. Werden die Erneuerbaren Energien entsprechend der aktuellen politischen Zielsetzung ausgebaut, ergibt sich für 2040 ein bilanzieller jährlicher Saldo für Stromflüsse aus Nachbarbundesländern (Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz) oder Nachbarländern (Frankreich, Schweiz) von 63 TWh im Basisszenario, 16 TWh im Effizienzszenario und 69 TWh im Elektrifizierungsszenario. Weitere Kraftwerke wie Wasserstoffkraftwerke werden auch in Baden Württemberg zur Stromerzeugung beitragen und die bilanzielle Lücke reduzieren, allerdings nur im Umfang von ca. 10 TWh. Es wird daher geschätzt, dass Baden-Württemberg im Jahr 2040 Stromnettoimporteur ist. Die Realisierung von hohen Installationswerten von Solar- und Windkraftanlagen in Baden-Württemberg reduziert die Abhängigkeit und stärkt die Resilienz im Stromsystem in Baden-Württemberg. Der Strompreis für verschiedenen Verbraucher könnte entsprechend niedriger sein als im Falle eines hohen Strombezugs von außerhalb.
Ein entsprechender Zubau an Erneuerbaren Energien, selbst auf Basis der aktuellen politischen Zielsetzung, ist höchst herausfordernd. Um wenigstens eine jahresbilanzielle Versorgung sicher zu stellen, müssten die politischen Zielsetzungen weiter verschärft und die Rahmenbedingungen verbessert werden. Um die vorhandenen Potenziale der Erneuerbaren Energien schneller und vollständiger zu heben, können verschiedene Maßnahmen von unterschiedlichen Akteuren in Baden-Württemberg angestoßen, implementiert und realisiert werden. Die Politik kann dazu beitragen, indem sie das Ziel der Klimaneutralität 2040 um konkrete Ausbauziele mit sinnvollen Rahmenbedingungen ergänzt, deren Erreichung jährlich überprüft wird. Planungs- und Genehmigungszeiten bei Windkraftprojekten sollten weiter verringert werden. Vorrangflächen, wie sie für die Windenergie ausgewiesen werden, sollten auch für PV-Anlagen vorgesehen werden. Wo rechtliche Hürden für den Ausbau bestehen, sollten diese konsequent durch die Politik abgebaut werden.
Auf Seiten der Interessenvertretungen, wie der IHK-Organisation, besteht die Möglichkeit durch Aufklärungs- und Informationskampagnen mehr Unternehmen für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu gewinnen und gleichzeitig auf eine umfangreiche Energiebereitstellung aus Erneuerbaren Energien sowie eine sichere Energieinfrastruktur im Land hinzuweisen. Gleichzeitig sollten Industrievorhaben in Bezug auf Investitionen in Zukunftstechnologien (im Feld der CO2-freie Energieversorgung) sowie die Schulungen von Fachkräften in den verschiedenen Branchen unterstützt werden.
Die Unternehmen als potenzielle Anlagenbetreiber selbst sollten sich aktiv mit ihren Möglichkeiten, EE-Anlagen zu betreiben sowie Elektrifizierungsmaßnahmen umzusetzen, auseinandersetzen. Hierbei ist insbesondere der langfristige Blick in Bezug auf Energiekosten (CO2 Bepreisung als hoher Kostenfaktor) wichtig.
Auch Energieversorger und Netzbetreiber können bei der Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien unterstützen, indem sie Anlagenbetreiber beim Netzanschluss der Anlagen mit schlanken Verfahren unter die Arme greifen sowie individuelle Beratung bei großen Anlagen anbieten. Gerade durch höhere Stromflüsse aus Nachbarregionen von Baden-Württemberg muss der Netzausbau im Sinne einer guten Strom- und Energieversorgung der Unternehmen in Baden-Württemberg von zentraler Wichtigkeit werden. Hierbei ist auch die Anschlussverstärkung von Industriebetrieben an das Mittelspannungsnetz entscheidend. Nur wenn alle Akteure dazu beitragen, kann die Energiewende gelingen.