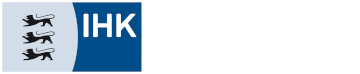Der dynamische Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg ist einer der stärksten in Europa und überwiegend von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) geprägt. Als Kreditgeber schaffen zudem Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken in der Breite sowie Privatbanken die notwendige finanzielle Basis für den Mittelstand. KMU und Kreditgeber sehen sich in der ökologischen und digitalen Transformation zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Wichtig sind praxistaugliche, nachvollziehbare und mittelstandsfreundliche Regelungen – gerade auf europäischer Ebene. Unser Appell an die EU-Politik: KMU und die sie finanzierenden Kreditinstitute benötigen mehr Freiraum und Entlastung, um ihre Schlüsselrolle im Transformationsprozess weiterhin erfüllen zu können.
1. Baden-württembergische Wirtschaft unterstützt ökologische und digitale Transformation
Die baden-württembergische Wirtschaft unterstützt das europäische Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Die Sustainable Finance-Strategie der EU ist für die mittelständische Real- und Finanzwirtschaft allerdings kaum beherrschbar. Wir plädieren für eine KMU-orientierte Weiterentwicklung der EU-Taxonomie und der Anforderungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Die Dekarbonisierung des Gebäudebestandes ist ein wichtiger Bestandteil der EU-Vorhaben, die zur Erreichung der Klimaziele führen sollen. Mit der Überarbeitung der Europäischen Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) drohen allerdings die Anforderungen an Gebäude nicht nur voraussichtlich strenger, sondern auch komplexer zu werden. Wir lehnen eine Sanierungspflicht von Bestandsgebäuden konsequent ab. Der Weg hin zu einem emissionsfreien Gebäudebestand in der EU bis 2050 soll durch Anreize nicht durch Pflichten erreicht werden.
Das Ziel, die Kreislaufwirtschaft zu fördern und Waren länger zu nutzen, um so das Abfallaufkommen zu verringern, das durch das „Recht auf Reparatur“ auf europäischer Ebene gesetzlich verankert werden soll, wird unterstützt. Das vorgeschlagene Europäische Formular für Reparaturinformationen lehnen wir ab, denn es gilt, zusätzliche bürokratische Belastungen für mittelständische Betriebe zu vermeiden. Auch die Pläne, den Einsatz von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) pauschal zu beschränken, würden Unternehmensprozesse und Produkte zusätzlich belasten und immense wirtschaftliche Folgen in unterschiedlichen Branchen nach sich ziehen.
Auch die Produkthaftungsrichtlinie soll novelliert werden, um sie an neue digitale Technologien und neue Geschäftsmodelle im Rahmen der Kreislaufwirtschaft anzupassen. Als Hersteller eines Produktes darf nur gelten, wer für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Produkts verantwortlich ist. Bei Produkten mit integrierter Software beispielsweise darf als Hersteller im Sinne der Produkthaftung nur gelten, wer Software und Updates zur Verfügung stellt. Haftungsrisiken für verarbeitende Betriebe müssen dagegen vermieden werden.
Um Reparaturdienstleistungen anbieten zu können, ist es außerdem von zentraler Bedeutung, dass Unternehmen Zugang zu den Daten erhalten, die von vernetzten Maschinen generiert werden. Der Data Act bietet den allgemeinen Rahmen dafür. Sektorspezifische Regelungen sollten diesen Rahmen ergänzen.
2. Flexible Ausgestaltung statt umfangreicher Regeln für den Mittelstand
Mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung, der EU-Taxonomie und dem EU Lieferkettengesetz nehmen bürokratische Anforderungen an Unternehmen vor allem in den Bereichen der Melde- und Offenlegungspflichten zu. Wir wünschen uns deshalb ein sicht- und spürbares mittelstandspolitisches Bekenntnis der EU-Kommission als selbstverpflichtendes Prinzip, bei ihren Initiativen von Anfang an die Vermeidung von Bürokratie für den Mittelstand mitzudenken und grundsätzlich negative Konsequenzen zu vermeiden.
Da KMU überproportional stark von Regulierungen betroffen sind, sollte der Mittelstandsfreundlichkeit von Rechtsakten eine höhere Priorität bei der europäischen Rechtsetzung eingeräumt werden. Bereits bestehende Berichtspflichten müssen überprüft und anschließend themen- sowie bereichsübergreifend gebündelt und reduziert werden. Auch sollte die EU bei ihrer Gesetzgebung eine Bürokratiebremse wie die „One-in-one-out“ Regel konsequent anwenden und ihre Vorhaben nach Dringlichkeit priorisieren. Zudem müssen spezifische KMU-Maßnahmen, wie das im September 2023 von der Kommission vorgelegte “KMU-Entlastungspaket“, konkrete, KMU-spezifische Entlastungen bringen. Dazu müssen ressortübergreifend abgestimmte Maßnahmen gehören, wie die dringend benötigte Reduzierung der Berichtspflichten, der konsequente Bürokratieabbau und eine kohärente Mittelstandspolitik.
3. Finanzierung für den Mittelstand sichern
Der Mittelstand ist im Transformationsprozess zu nachhaltigen und digitalen Geschäftsmodellen auf eine verlässliche Kreditfinanzierung angewiesen. In Baden-Württemberg wird dies durch eine Vielzahl von Kreditinstituten gewährleistet. Diese Institute benötigen ausreichende Möglichkeiten zur Kreditvergabe, die nicht durch ausufernde Regulatorik beschränkt werden darf. Wir begrüßen daher den Erhalt des KMU-Faktors bei Basel III final. Nicht nachvollziehbar ist, dass der Kreditvergabespielraum durch zusätzliche Eigenkapitalbelastungen bei strategischen und langfristigen Beteiligungen eingeschränkt wird. Enttäuschend ist für risikoarme kleinere Kreditinstitute, dass das Thema Proportionalität nur unzureichend aufgegriffen wurde. Die lange versprochene „Small and Simple Banking Box“ gilt es mit Vereinfachungen und Ausnahmen für kleinere und mittlere Kreditinstitute sowie ihr vergleichsweise risikoarmes Mittelstandsgeschäft zu befüllen. Insbesondere die Melde- und Dokumentationspflichten belasten kleine und mittlere Institute unverhältnismäßig stark. Es bedarf dringend einer Entlastung der Kreditinstitute von administrativen Lasten, um weiterhin ein zuverlässiger und starker Partner des Mittelstands zu bleiben. Stattdessen drohen über das ESG-Reporting absehbar zusätzliche Belastungen geschaffen zu werden. Auch weitere Einschränkungen der Kreditinstitute durch europäische Abwicklungsregelungen sind kontraproduktiv. Daher lehnen wir die Vorschläge der EU-Kommission zur Reform
er Bankenabwicklung und der Einlagensicherung (CMDI-Review) ab.
4. Souveränität Europas erhalten – Wettbewerbsfähigkeit stärken
Baden-Württemberg liegt mitten im Herzen Europas und profitiert besonders vom europäischen Binnenmarkt, der nun seit 30 Jahren besteht. Aber auch nach 30 Jahren gibt es Hindernisse: Melde-, Statistik- oder Nachweispflichten schränken den freien Verkehr innerhalb der EU ein. Die entstehenden Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern sind oft intransparent und nur mit entsprechender Fach- und Sprachkenntnis umsetzbar. Für grenzüberschreitend tätige kleine und mittlere Unternehmen ist der Abbau von bestehenden Hemmnissen im EU-Binnenmarkt von hoher Priorität. Außerdem ist eine ausreichende Anzahl gut qualifizierter Fachkräfte ein elementarer Faktor für den wirtschaftlichen und unternehmerischen Erfolg sowie Beschäftigung und Wohlstand in der EU. Für die EU ist eine europaweite und vorausschauende Fachkräftestrategie aus Sicht der Wirtschaft ein Gebot der Stunde.
Baden-Württemberg als Transformationsregion mit vielfältigen Innovationsclustern und Leitindustrien hat sich ehrgeizige Ziele im Bereich der Energie- und Klimapolitik gesetzt. So ist der Transformationsdruck besonders in Baden-Württemberg hoch, doch das EU-Beihilferecht setzt enge Grenzen bei der Förderung und dem Ausbau von Zukunftstechnologien. Auch von der Transformation stark betroffene Regionen wie Baden-Württemberg brauchen gleiche Rahmenbedingungen wie strukturschwächere EU-Regionen für einen fairen Wettbewerb.
Der Inflation Reduction Act der USA sollte ein Weckruf für die EU sein. Als adäquate Antwort braucht auch die EU eine neue Agenda zur nachhaltigen Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Dazu müssen vor allem die Standortfaktoren innerhalb der EU wieder unternehmensfreundlicher gestaltet werden. Der Green Deal liefert zwar erste Ansatzpunkte. Statt staatlicher Lenkung der Wirtschaft durch Diversifizierungspflichten, Produktionsvorgaben und einem Mehr an bürokratischen und regulatorischen Anforderungen benötigen gerade die mittelständischen Unternehmen aber vor allem positive Anreize und branchenübergreifend gute Rahmenbedingungen. Durch Vereinfachung entsteht neuer Raum für Entwicklung und Innovation.